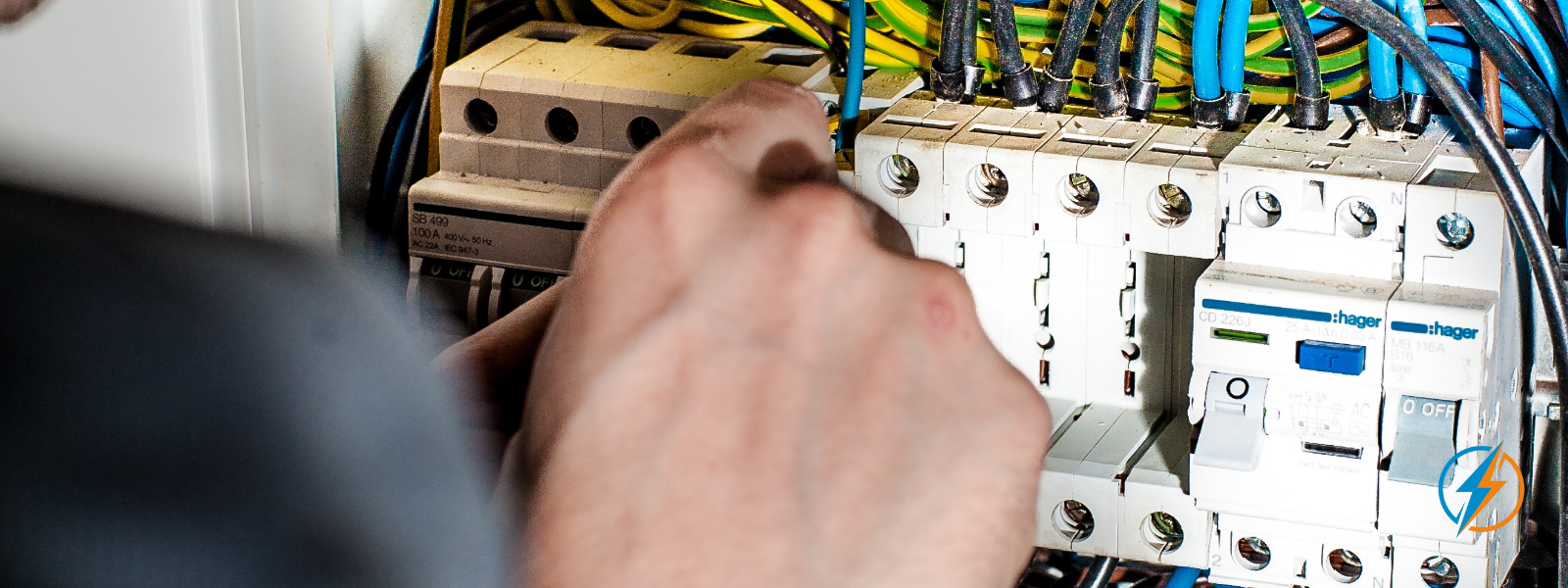Das bisherige Netzentgelt-System passt nicht mehr zur Energiewende
Die heutigen Regeln der Stromnetz-Verordnung stammen aus einer Zeit stabiler Großkraftwerke und zentraler Energie-Versorgung. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, erklärt klar: „Die alten Netzentgelt-Rabatte passen nicht mehr zu einem Stromsystem mit viel Ökostrom.“ Denn die Wirkung der besonderen Netznutzung hat sich in Stromnetzen mit viel grüner Energie stark verringert. Das bisherige System belohnte gleichmäßigen Stromverbrauch, obwohl heute die größten Netzkosten durch schwankende Wind- und Solareinspeisung entstehen.
LESEN SIE AUCH | Studie bestätigt: E-Autos haben deutlichen Klimavorteil
Die finanziellen Folgen zeigen deutlich den Handlungsdruck: Für 2025 rechnen die Netz-Betreiber mit Kosten von 4,41 Milliarden Euro für den „Aufschlag für besondere Netznutzung“. Die entsprechende Umlage stieg dramatisch von 0,643 ct/kWh in 2024 auf 1,558 ct/kWh in 2025 – also um 142 Prozent.
Strompreise bestimmen künftig die flexibilitätsbasierten Netzentgelte
Das neue Konzept der Bundesnetzagentur koppelt flexibilitätsbasierte Netzentgelte direkt an Börsenstrompreise. Denn diese zeigen die aktuelle Strom-Situation am besten und spiegeln das Verhältnis von Angebot und Nachfrage wider. Unternehmen bekommen künftig nur dann Vergünstigungen, wenn sie bei niedrigen Strompreisen deutlich mehr verbrauchen als im Jahresdurchschnitt und bei hohen Preisen entsprechend weniger.
LESEN SIE AUCH | Kleinunternehmerregelung PV 2025: Steuerfreier Eigenverbrauch
Diese Flexibilität schafft erstmals echte Anreize für intelligente Lastverschiebung und revolutioniert damit die bisherige Netzentgelt-Struktur. Denn Industriebetriebe müssen ihre Produktion so planen, dass sie bei viel Ökostrom mehr verbrauchen und bei Knappheit weniger. Die Bundesnetzagentur plant regionale Ausnahmen für Gebiete mit wenig dezentraler Ökostrom-Einspeisung, wo Netzprobleme weiterhin hauptsächlich durch hohen Verbrauch entstehen.
80 Prozent Netzentgelt-Ersparnis durch Bandlastprivileg fallen weg
Das traditionelle Bandlastprivileg nach §19 StromNEV bot Unternehmen mit gleichmäßigem Stromverbrauch über mindestens 7.000 Stunden jährlich erhebliche Kostenvorteile. Diese Regelung stammte aus der Zeit, als das Stromsystem auf planbare Grundlastkraftwerke ausgelegt war und gleichmäßiger Verbrauch tatsächlich die Netzkosten senkte.
Unternehmen konnten durch diese Vergünstigung bis zu 80 Prozent ihrer Netzentgelte einsparen, was besonders für energieintensive Branchen wie die Chemie-, Stahl- oder Aluminiumindustrie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellte. Die Abschaffung des Bandlastprivilegs bedeutet für viele Unternehmen eine grundsätzliche Neuausrichtung ihrer Energiestrategie. Während bisher Konstanz belohnt wurde, verlangen flexibilitätsbasierte Netzentgelte nun genau das Gegenteil: variable Anpassung an Marktbedingungen.
BDI warnt vor Standortverlagerungen ins Ausland
Der Bundesverband der Deutschen Industrie kämpft vehement dafür, dass die Stromnetz-Verordnung mindestens bis Ende 2028 unverändert bleibt. Denn es geht um die „Zukunft des Industriestandortes Deutschland“ – und zwar nicht nur für direkt betroffene Betriebe, sondern auch für ganze Wertschöpfungsketten. Außerdem können besonders kontinuierliche Produktionsprozesse in der Glas- oder Chemieindustrie nur sehr begrenzt flexibel gestaltet werden.
LESEN SIE AUCH | ETS2 ab 2027: Erfolgsstrategien für Unternehmen
Die Industrieverbände befürchten, dass flexibilitätsbasierte Netzentgelte zu einem massiven Kostenschock führen könnten, wenn Unternehmen ihre Produktionsprozesse nicht rechtzeitig umstellen können. Der Verband der Chemischen Industrie setzt sich für „möglichst lange Übergangsregelungen“ ein, während der Bundesverband Glasindustrie auf die physischen Grenzen von Dauer-Schmelzprozessen hinweist. Besonders mittelständische Unternehmen befürchten, dass sie nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um komplexe Flexibilitätsstrategien zu entwickeln.
Bestandsschutz für laufende Netzentgelt-Vereinbarungen bis 2028
Die Bundesnetzagentur plant keine sofortige Abschaffung bestehender Netzentgelt-Vereinbarungen beim Übergang zu flexibilitätsbasierten Netzentgelten. Denn großzügige Übergangsfristen sollen Unternehmen genug Zeit geben, Produktionsprozesse umzustellen und neue Flexibilitäten zu entwickeln. Außerdem soll diese schrittweise Umstellung Investitionssicherheit bewahren und betriebswirtschaftliche Anpassungen ermöglichen. Nach der Beratungsphase bis September 2024 arbeitet die Bundesnetzagentur intensiv an der konkreten Ausgestaltung der flexibilitätsbasierten Netzentgelte.
LESEN SIE AUCH | Sektorenkopplung 2025: Neue Chancen für PV-Projektmanager
Der Starttermin 1. Januar 2026 lässt wenig Spielraum für große Änderungen am Grundkonzept, während Details der Umsetzung noch verhandelbar sind. Ein wichtiger Aspekt betrifft die Bestandssicherung laufender Investitionen. Unternehmen, die in den letzten Jahren große Summen in energieeffiziente Anlagen investiert haben, sollen bei der Einführung flexibilitätsbasierter Netzentgelte angemessen berücksichtigt werden.
Geteilte Meinungen zwischen Befürwortern und Kritikern
Energieexperten wie Felix Matthes vom Öko-Institut Berlin bewerten die Einführung flexibilitätsbasierter Netzentgelte als überfälligen Schritt. Denn sie beseitigen „Flexibilitäts-Hindernisse“ und können große Systemvorteile bringen, wenn sie richtig umgesetzt werden. Das bisherige Bandlastprivileg habe in einem System mit volatilen erneuerbaren Energien keinen Sinn mehr und behindere sogar die Integration von Wind- und Solarstrom.
Christof Wittwer vom Fraunhofer ISE unterstützt ebenfalls die grundsätzliche Reform hin zu flexibilitätsbasierten Netzentgelten, warnt aber vor zusätzlichen Stromkosten-Belastungen für die Industrie. Industrievertreter argumentieren dagegen, dass flexibilitätsbasierte Netzentgelte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusätzliche Kostenbelastungen schaffen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produktionsstandorte gefährden. Pragmatische Experten plädieren für branchenspezifische Lösungen, die technische Restriktionen kontinuierlicher Produktionsprozesse anerkennen.
Batteriespeicher und intelligente Steuerung werden wichtiger
Unternehmen müssen ihre Produktionsprozesse systematisch auf Flexibilisierungs-Möglichkeiten prüfen, um von flexibilitätsbasierten Netzentgelten zu profitieren. Dabei geht es nicht nur um die Verlagerung von Produktionszeiten, sondern auch um den strategischen Einsatz von Batteriespeichern, Power-to-Heat-Systemen oder anderen lastverschiebenden Technologien. Denn die frühzeitige Investition in solche Systeme kann entscheidende Wettbewerbsvorteile bei flexibilitätsbasierten Netzentgelten sichern. Das ist auch vorteilhaft beim netzoptimierten Laden von Elektrofahrzeugen.
LESEN SIE AUCH | Smart Meter Deutschland 2025: Rollout, Kosten & Chancen
Besonders intelligente Steuerungssysteme gewinnen an Bedeutung, da sie automatisch auf Preissignale reagieren und den Stromverbrauch optimieren können. Das neue System flexibilitätsbasierter Netzentgelte braucht außerdem genaue Vorhersagen von Strompreis-Entwicklungen. Betriebe mit begrenzten Flexibilisierungs-Möglichkeiten sollten alternative Wertschöpfungsansätze prüfen, wie Systemdienstleistungen für Netzbetreiber oder die Integration in virtuelle Kraftwerke.
Milliardeneinsparungen bei erfolgreicher Umsetzung möglich
Die flexibilitätsbasierten Netzentgelte können erhebliche volkswirtschaftliche Effizienzgewinne erzeugen, wenn sie Netzausbaukosten reduzieren und die Integration erneuerbarer Energien beschleunigen. Denn optimierte Lastverteilung vermeidet teure Netzeingriffe und reduziert kostspielige Abregelungen von Windkraft- und Solaranlagen. Studien zeigen, dass intelligente Nachfragesteuerung durch flexibilitätsbasierte Netzentgelte jährlich mehrere Milliarden Euro einsparen könnte.
Die Reform könnte außerdem deutsche Unternehmen zu Vorreitern bei industrieller Lastflexibilisierung machen und internationale Technologieführerschaft in diesem wichtigen Bereich begründen. Gleichzeitig bergen schlecht durchdachte flexibilitätsbasierte Netzentgelte erhebliche Standortrisiken. Wenn deutsche Industrieunternehmen durch ungeeignete Flexibilitäts-Anforderungen benachteiligt werden, könnte dies Produktionsverlagerungen in Länder mit stabileren Energiekostenstrukturen beschleunigen.
Wegweisende Reform oder industriepolitisches Risiko?
Die Netzentgelt-Reform nach §19 StromNEV markiert einen historischen Systemwechsel von starren Vergünstigungen zu intelligenten flexibilitätsbasierten Netzentgelten. Erfolgsentscheidend wird sein, ob die Bundesnetzagentur praxistaugliche Übergangsregelungen schafft und branchenspezifische Besonderheiten angemessen berücksichtigt. Denn Unternehmen, die frühzeitig in moderne Flexibilisierungs-Technologien investieren und ihre Geschäftsmodelle clever anpassen, können auch im neuen System flexibilitätsbasierter Netzentgelte von attraktiven Rabatten profitieren.
LESEN SIE AUCH | Negative Strompreise 2025: Unternehmen kassieren Geld
Die kommenden Monate bis zur Einführung flexibilitätsbasierter Netzentgelte 2026 werden zeigen, ob Deutschland den schwierigen Spagat zwischen energiesystemischen Erfordernissen und industriepolitischen Zielen erfolgreich meistert. Sollte die Reform gelingen, könnte Deutschland zum globalen Vorbild für die intelligente Integration von Industrie und erneuerbaren Energien werden.
FAQ zu flexibilitätsbasierten Netzentgelten
Was ist das Bandlastprivileg genau?
Das Bandlastprivileg nach §19 StromNEV reduziert Netzkosten für Unternehmen mit konstant hohem Stromverbrauch über mindestens 7.000 Stunden jährlich und einem Mindestverbrauch von 10 GWh. Diese Regelung stammt aus der Zeit klassischer Grundlastkraftwerke, als gleichmäßiger Verbrauch die Netzdimensionierung optimierte. Qualifizierte Betriebe zahlen nur etwa 20% der üblichen Netzentgelte. Ab 2026 entfällt dieses Bandlastprivileg komplett, da es im erneuerbaren Energiesystem kontraproduktiv wirkt und Flexibilität verhindert.
Wie profitieren Unternehmen mit Batteriespeichern von flexibilitätsbasierten Netzentgelten?
Batteriespeicher ermöglichen es Unternehmen, bei niedrigen Strompreisen Energie zu speichern und bei hohen Preisen zu entladen. Dies erfüllt perfekt die Anforderungen flexibilitätsbasierter Netzentgelte. Ein 1-MW-Speicher kann bei optimaler Nutzung jährlich 50.000-100.000 Euro an Netzentgelten einsparen. Zusätzlich können Betriebe durch Regelenergie-Vermarktung und Peak-Shaving weitere Erlöse erzielen. Intelligente Speicher-Management-Systeme reagieren automatisch auf Preissignale und maximieren die Kosteneinsparungen ohne Eingriffe in die Produktion.
Was bedeutet netzoptimiertes Laden für E-Auto-Flotten?
Netzoptimiertes Laden verschiebt das Laden von Elektrofahrzeugen in Zeiten niedriger Strompreise und hoher Ökostrom-Produktion. Unternehmen mit größeren E-Auto-Flotten können so erheblich bei flexibilitätsbasierten Netzentgelten sparen. Eine 50-Fahrzeug-Flotte kann durch intelligentes Lademanagement jährlich 15.000-25.000 Euro einsparen. Moderne Ladeinfrastruktur mit Smart-Grid-Anbindung erkennt automatisch günstige Tarif-Zeitfenster und optimiert den Ladeprozess entsprechend. Bidirektionales Laden ermöglicht sogar die Rückspeisung ins Netz bei Bedarf.
Welche Branchen können am besten flexibilisieren?
Besonders geeignet für flexibilitätsbasierte Netzentgelte sind Branchen mit speicherbaren Produktionsprozessen: Wasserstoff-Herstellung, Druckluft-Erzeugung, Kälteanlagen, Recycling-Betriebe und Rechenzentren. Diese können ihre Lastspitzen gezielt in günstige Preisstunden verschieben. Schwieriger wird es für kontinuierliche Prozesse wie Glasschmelzen oder Stahlproduktion. Überraschend flexibel sind jedoch Zementwerke durch verschiebbare Mahlprozesse oder Papierfabriken durch anpassbare Trocknungszyklen. Insgesamt haben etwa 40% der deutschen Industrieunternehmen signifikante Flexibilisierungspotenziale.
Wie funktioniert die Netzlastreduzierung in der Praxis?
Netzlastreduzierung erfolgt durch intelligente Steuerungssysteme, die Produktionsanlagen automatisch an Strompreise anpassen. Moderne Energie-Management-Systeme überwachen kontinuierlich die Börsenstrompreise und schalten energieintensive Prozesse bei Bedarf ab oder reduzieren sie. Beispiel: Eine Aluminiumhütte kann ihre Elektrolyse-Leistung binnen Minuten um 20-30% reduzieren. Notstrom-Aggregate können bei Netzspitzen zugeschaltet werden. Durch Demand-Response-Programme erhalten Unternehmen zusätzliche Vergütungen für schnelle Laständerungen. Die Technik ist ausgereift und bereits in vielen Betrieben erfolgreich im Einsatz.
Ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich die Umstellung auf flexibilitätsbasierte Netzentgelte?
Die Umstellung lohnt sich bereits ab einem Stromverbrauch von 1-2 GWh jährlich, besonders bei gleichzeitig hohen Lastspitzen. Kleinere Betriebe können durch Zusammenschluss in virtuellen Kraftwerken oder über Energiedienstleister profitieren. Die Investitionskosten für Mess- und Steuerungstechnik liegen bei 10.000-50.000 Euro, amortisieren sich aber meist binnen 2-3 Jahren. Entscheidend ist nicht nur die Größe, sondern das Flexibilisierungspotenzial: Ein 500-kW-Betrieb mit flexiblen Prozessen kann mehr sparen als ein 2-MW-Betrieb mit starren Abläufen.
Was passiert bei Nichteinhaltung der Flexibilitäts-Vorgaben?
Bei Nichteinhaltung der Flexibilitäts-Vorgaben verlieren Unternehmen ihre Netzentgelt-Vergünstigungen und müssen die vollen Netzkosten zahlen. Die Bundesnetzagentur plant jedoch keine Strafzahlungen, sondern ein abgestuftes System. Kleinere Abweichungen werden toleriert, größere führen zu proportionalen Kürzungen der Rabatte. Technische Ausfälle oder Produktionsnotwendigkeiten werden berücksichtigt. Unternehmen können Flexibilitäts-Reserven aufbauen oder sich über Dienstleister absichern. Ein Monitoring-System überwacht kontinuierlich die Einhaltung und warnt frühzeitig vor kritischen Abweichungen.
8.Welche Förderprogramme gibt es für die Umstellung?
Die Bundesregierung plant spezielle Förderprogramme für die Umstellung auf flexibilitätsbasierte Netzentgelte. Das Bundeswirtschaftsministerium stellt bis zu 500 Millionen Euro für Flexibilisierungs-Investitionen bereit. Gefördert werden Batteriespeicher (bis 40% der Kosten), intelligente Steuerungssysteme (bis 50%) und Beratungsleistungen (bis 80%). Die KfW bietet zinsgünstige Kredite für größere Investitionen. Zusätzlich können Länder eigene Programme auflegen. Antragsberechtigt sind Unternehmen aller Größen, wobei KMU bevorzugt werden. Die Förderung ist bis Ende 2027 verfügbar und kann online beantragt werden.